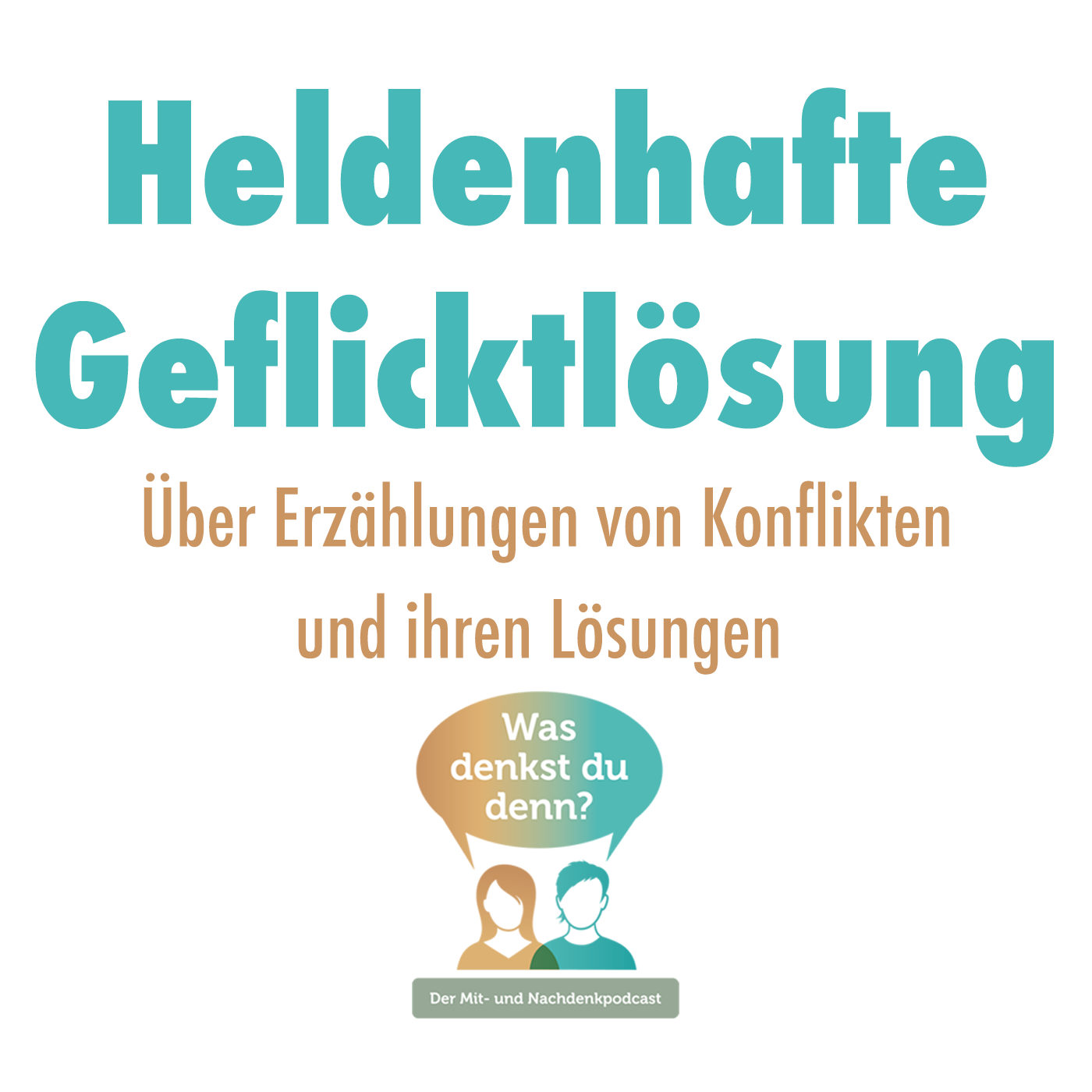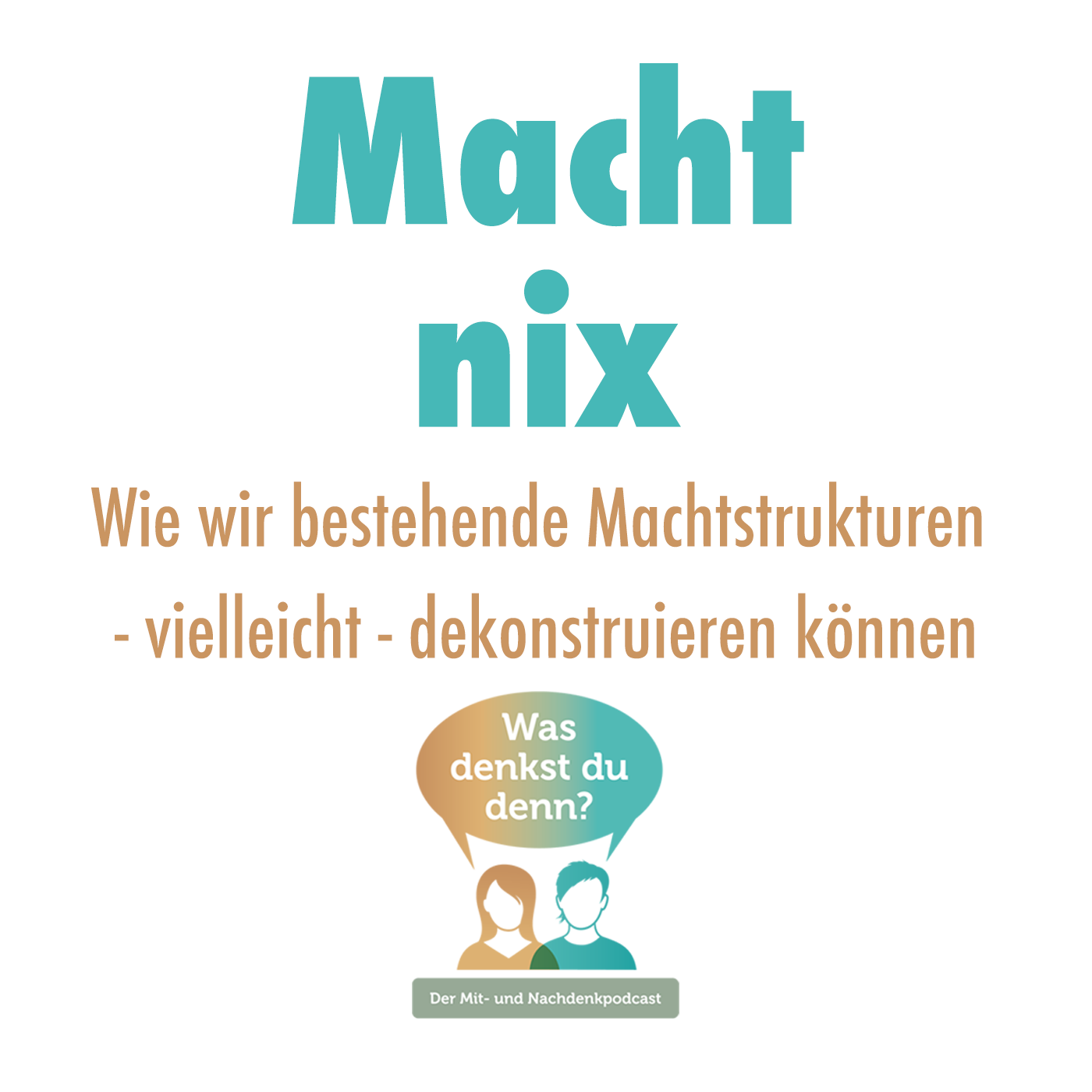Glitzertops in Oer-Erkenschwick
Die Serie "Sex and the City" hat in den 90er Jahren eine ganze Generation junger bis mittelalter Frauen geprägt. Oder wie Rebekka Endler sagt: "Das haben unsere Mütter geguckt!" Der Einfluss auf den Modestil der 90er Jahre ist nicht von der Hand zu weisen. Aber spannend ist eben auch, was nicht erzählt wurde, sagt Rita. Und das, was wir heute definitv anders sehen und bewerten als eben noch in den 90ern.